|
Die pythagoräische
Lebensweise der Philosophen
Die alten Philosophen
suchten im Wesentlichen nach den Antworten auf die
ewigen Fragen des Menschen, warum dieses Leben so
bitter, oft unerfüllt, scheinbar sinnlos und
voller Krankheiten und Leid ist. Ihre
Erkenntnisse brachten zutage, dass der Mensch ein
langes, erfülltes Leben (120-150 Jahre) erreichen
kann, wenn er mit der Natur und nicht gegen die Natur
lebt.
Auffallend aber ist,
dass die Philosophen selbst dieses hohe Alter oft
nicht erlangten. Warum nicht, so fragt man sich.
Beschäftigt man sich aber eingehender mit ihnen,
so erfasst man, dass sie eben Pioniere waren, die
ja auch auf der Suche nach den verlorengegangenen
Naturgesetzen waren und diese oft nur teilweise enträtselt
haben. Ohne ihr Suchen und ohne ihre Erfahrungen und
Schriften aber wüssten wir heute noch weniger
als die Naturvölker, die sich noch von einem
guten Instinkt leiten lassen.
Es gibt Stämme,
besonders in Nordamerika, die das Wissen um den Menschen
und um die Natur in der letzten Eiszeit nicht verloren
hatten. Durch mündliche Tradition erhielten sie
das, was die Philosophen mit Mühe finden. Das
Naturgesetz der natürlichen Ernährung ist
leicht zu kontrollieren, wenn man es lebt.
Die primordialen, die ursprünglichen Menschen
erreichen das Durchschnittsalter von 110 bis 130 Jahren.
Zivilisationskrankheiten kennen sie nicht.
Vivisektion
In Deutschland werden
jährlich mindestens 10.000.000 Tiere in der sogenannten
Forschung umgebracht, damit der Wissenschaftler
bestimmte Medikamente auf ihre Wirkungsweise hin prüft.
Viel schmerzloser wäre es zu beobachten, wie
eine bestimmte Ernährung auf den Menschen wirkt.
Philosphisch veranlagte
Menschen haben das getan. Wir haben Berichte von solchen
Studien seit Herodot, Hippokrates, Zarathustra,
Pythagoras, Platon, seit Kirchenvätern über
die Essener bis zu Cornaro, Leonardo da Vinci, Montaigne,
Voltaire, Wagner, Tolstoi und Schweitzer. So haben
wir endlich gute Resultate, denn die Aussagen der
Denker ergänzen sich und widersprechen sich nicht,
sondern weisen alle, dieselbe Richtung. Keine Therapie,
keine Medizin hat so geholfen wie die Lebensweise,
die die Früchtenahrung kennt. Mit "Früchten"
sind jene Produkte der Pflanzen gemeint, die Fruchtfleisch
und Kerne (Samen) haben. Menschen, die sich von Früchten
ernähren, werden "Frutarier" oder "Frugivoren"
genannt. Karotten, Weizenkörner, Nüsse oder
Eier sind nach dieser Begriffsbestimmung keine Früchte.
Die folgenden Forscher
sind nach meinen Beobachtungen die wissenschaftlichen
Bahnbrecher des neuen Lebens, der neuen Kultur:
- Arnold Ehret
- der Entdecker der schleimfreien Diät
- Dr. Edmond
Bordeaux-Szekely - der Essenerforscher
- Dr. George
Clements - Historiker
- Dr. Leon A.
Wilcox - Heilung der Menschen mit Orangen
- Henry Bailey
Stevens - Kulturforscher, Entdecker des
Zusammenhangs zwischen Höherentwicklung und
Baumkultur
- Dr. Richard
St. Barbe Baker - Heiler der Welt
- Dr. Anna Kingsford
- Walter Sommer
- das Urgesetz der natürlichen Ernährung
Auf Grund der Erkenntnisse,
die diese großen Männer entdeckt haben,
wird in den nächsten Jahren eine neue, echte
Ernährungswissenschaft entstehen, denn sie
haben die Erfahrungen der Geschichte zusammengefasst
und die gewonnenen Ergebnisse an sich selbst erprobt.
Dass die Höherentwicklung
erst mit den Baumfrüchten, als Stufenleiter der
Zivilisation, möglich wurde, ist sehr einleuchtend.
Die Urgeschichte
Wenn wir Carl Boetticher
und H. B. Stevens folgen, erfahren wir, dass die
Urvölker in inniger Verbundenheit mit den Bäumen
lebten (die Bischnoi in Rajastan tun das z.B. heute
noch, sie schützen die Bäume mit ihrem eigenen
Leben).
Die Urreligion war eine Naturreligion in dem Sinne,
dass die Menschen auf jener Stufe eine hohe, unfassbare
Intelligenz am besten in der Natur, in den Bäumen
vorfanden. Deshalb verehrten die ältesten Völker
den hohen Geist in der Natur, d.h. in und bei den
heiligen Bäumen und Hainen.
Respektvoll standen sie vor der Vielfalt der Kräfte,
die in den Bäumen walten. Bäume waren Vertreter
hoher Geistwesen.
Jene Völker wussten wohl noch, dass Verschiedenartigkeit
durch verschiedene Intelligenzen hervorgebracht wird.
Die moderne Forschung
war und ist blind für dieses Wissen der Alten.
Wenn sich früher Stammesführer unter den
von ihnen verehrten Bäumen versammelten, um Feste
zu begehen oder schwerwiegende Entscheidungen zu treffen,
dann sicher deswegen, weil sie wussten, welche enormen
Kräfte durch die Natur in die Menschen fließen.
Im 4. Jahrhundert
begann die Verfolgung solcher Feste und Riten.
Die christlichen Missionare und Kaiser, beginnend
mit Theodosius (347 - 395) gingen mit der Axt
gegen die Bäume vor, unter denen sich die Menschheit
naturgemäß entwickelt hatte. Und sie zwangen
den "missionierten" Völkern die künstlichen,
von Menschenhand gemachten, unnatürlichen Gotteshäuser
auf. Dies
war der Anfang der endgültigen Verwüstung
der Erde. Trotzdem konnte sich die Baumverehrung
bis zum 9. Jahrhundert halten und zwar besonders
in den nördlichen Breiten.
Der antike Baumkult
In der alten hellenistischen,
italischen und chinesischen Welt war ein religiöser
Kult nur dort möglich, wo heilige Bäume
standen oder eigens dafür angepflanzt wurden.
Boetticher schreibt dazu: "In der Ideenwelt
der Alten gibt es nichts isoliert Dastehendes, es
ist alles aus einer Wurzel und einem Stamm erwachsen,
jedes Einzelne ein Glied der großen Gedankenkette,
welches, aus seinem Zusammenhang gerissen, ohne Erklärung
dasteht.
Unter den Naturmalen,
welche man als Wohnsitze und sichtbare Bildformen
der Gottheit ansieht, kommen vornehmlich diejenigen
in Betracht, in welchen der Mensch nicht nur eine
seiner eigenen Natur engverwandte Lebenstätigkeit
erkannte, sondern an die er zu Erhaltung seiner physischen
Existenz auch am meisten gewiesen war: die lebensspendenden
(statt: lebennährenden) Pflanzen, vornehmlich
die Bäume; und weil der göttliche Geist
als ein ewig wacher und wirkender Geist gedacht ist,
sind dementsprechend unter den Bäumen diejenigen
welche grünend niemals ihr Laub abwerfen und
dabei eine über alle Erinnerung gehende Lebensdauer
haben, die als Vertreter der unvergänglichen
und nie schlummernden Gotteskraft betrachtet werden."
"Es sind vom Uranfang
an dem Hellenen, Latiner, Meder und Armenier, dem
Chaldäer wie dem dem Kananiter, dem Inder wie
dem Germanen und Kelten Bäume die ersten
Tempel und irdischen Abbilder der Gottheiten
gewesen, in welchen deren Geist hauste und mit
ihnen verkehrte, in welchen er seinen Willen durch
Vorzeichen und Orakel offenbarte. Schwer kann
es noch einen Zweifel geben, dass unter allen Naturmalen,
nächst dem Quell, die Bäume zuerst
als Heiliges verehrt wurden, dass Feuer und
Wasser die ältesten Zeichen heiligen Dienstes
gewesen seien. Denn wie der Mensch nicht ohne
den trankspendenden Quell, so vermag er nicht ohne
den Nahrung, Feuer und Nutzholz gebenden Baum zu leben.
Mit seltener Übereinstimmung
wird dieses ursprüngliche Heiligkeitsverhältnis
der Bäume, als lange Zeit vor dem Bilder- und
Tempeldienst bestehend und ihm vorausgehend von alten
Schriftquellen bezeugt.
Plinius meint: sie
ermangelten ebenso wenig der Seele, wie jedes andere
Lebende; es seien stets Bäume und Wälder
für das höchste Geschenk gehalten, was die
Natur dem Menschen verliehen. Von ihnen habe man
die erste Nahrung und Bekleidung bekommen, deswegen
wolle er mit der Beschreibung der Bäume auch
eine Darstellung der ursprünglichen ältesten
Sitten vereinigen.
Nach dieser Einleitung
fährt er dann weiter fort: Bäume seien
Tempel der Gottheiten gewesen; es weihe noch heute
der schlichte Landmann auf altherkömmliche Weise
den schönsten Baum einem Gott und man verehre
nicht die von Gold und Elfenbein strahlenden Götterbilder
in größerer Andacht, sondern die Haine
und das in ihnen herrschende feierliche Schweigen;
auch bestehe der Glaube, dass die Bäume den Silvanen,
Faunen und anderen Göttinnen, oder vielmehr
deren Numina, ebenso angehörten als der
Himmel den Göttern, daher blieben fortwährend
die verschiedenen Arten von Bäumen besonderen
Gottheiten geweiht: so die Eiche dem Jupiter,
die Olive der Minerva, die Myrte der Venus,
der Lorbeer dem Apollo, die Pappel dem Hercules.
2) Plin. 12,2. Bacc
fuerc numinum templa, priscoque rito simplicia
oorura etiam nume deo praccellentem arborem dicant.
Nee magis
ooauro fulgentia atque chore simulaera quam lucus
et in iis silentia
ooipsa adoramus. Arborum genera muninibus suis decata
perpetuo
ooservantur: at levi esculus, Apollini laurus, Minervae
olea, Veneri
oomyrtus, Herculi populus. Quin et Silvanos Faunosque
et dearum
oogenera silvis ac sua numina tanquam et caelo attributa
credimus.
5) Aristoph. av. 615 fg., wo Schol. 617
oo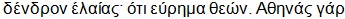
oo ganz richtig versteht.
6) St. Cyrillus in Isaiam.
oo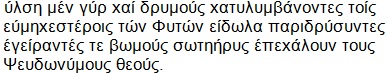
ooBeispielsweise jener Myrthenbaum als Artemis
ooSoteira zu Boia; vgl. Myrte.
7) Theophylactus, Comment. in S. Ios. c. 4, p. 616.
8) Zonaras Annal. T. 3. Leon Isaar. p. 82.
oo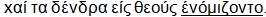
Dann führt er
weiter aus, welche Segensgaben die Menschen von den
Bäumen empfingen; es seien diese so bedeutend
dass sie ohne dieselben nicht zu leben vermöchten.
Einst, erzählt Phädrus wählten
die Götter Bäume, um in ihrem Schutz zu
sein; die Eiche gefiel dem Jupiter, die Myrte der
Venus u.s.w! Wir aber haben den Olivenbaum wegen seiner
Früchte lieber: (Oliva nobis propter fructum
est gratior. Phaedr. fab. III, 17)
Lukian holt noch weiter aus, wenn er sagt:
Es haben zuerst die Menschen den Göttern Haine
und Höhen geweiht, Vögel geheiligt und jeder
Gottheit einen besonderen Baum gegeben; sodann habe
jedes Volk sich seine besondere Gottheit gewählt
und als bei sich wohnend verehrt; zuletzt endlich
habe man den Göttern erst Tempel errichtet, ihnen
Bilder gemacht und geglaubt das seien die Götter
selbst. Wie deutlich sich die späten Athener
noch dieses ursprünglichen Verhältnisses
bewusst waren, erzählt Aristophanes.
Er verlangt, dass die Athener die Götter wieder
im Freien verehren und 'statt Tempel mit goldenen
Türen den Ölbaum zu Tempel weihen.'
Er spricht vom ursprünglichen
Zustand der Gottesverehrung, von jener Kultphase wo
der Ölbaum noch Bild und Tempel der Athena war,
bevor man ihr ein Bild und ein Tempelhaus stiftete."
(Boetticher Seite
8-11)
Plutarch, Klemens
von Alexandrien, Tertullian und Augustinus
schreiben, dass
die heiligen Bäume Roms älter waren als
die Stadt Rom, und dass in den ersten 170 Jahren
seiner Gründung Rom noch keine Götterbilder
hatte, also nur Bäume.
Plutarch, Numa 8; Clemens v. Alex., Strom. 1,71;
Tertull. Apolog. 25: "Etsi a Numa concepta
est curiositas superstitiosa, nondum tamen aut simulacris
aut templis res divina apud Romanos constabat et deus
ipse nusquam."
Augustinus De civ.
Dei 4,31 und 9 - Auch nach der Erscheinung der
Tempel aus Stein und den Göttern aus Marmor,
blieb doch die Verehrung des Lebens in den Bäumen
als die normale und wesentlichste Würdigung der
Gottheit. Die steinernen "Häuser Gottes"
in Dodona, Samos und Delphi sind am Anfang lediglich
Räume zur Aufbewahrung der Weihegeschenke.
Die Tempel dagegen entstehen erst mit dem Bilderdienst.
(Deshalb sagte Jesus auch: "Macht euch
kein Bild von Gott, sondern betet zu ihm in eurem
Herzen.")
Nur weil eine numinöse
Seele einen Baum belebt, werden die besonderen, individuellen
Götter der Bäume verehrt. Mit dem Baum entsteht
der Kult, mit ihm wandert er weiter. "Wohin die
Sacra als Filiale übersiedelt werden,
dahin führt man einen Sprössling vom
väterlichen Gottesbaum, pflanzt ihn auf und
heiligt ihn durch Gründung des Altars und
Speisetisches."
Herodot berichtet:
In Euphratländern wuchs kein Ölbaum und
kein Wein, sondern nur Sesam und Palmen. Aus diesem
Grund konnten die Kulte der Athena und des Dionysos
nicht dorthin verpflanzt werden. Auch später
war keine Stiftung eines Kultustempels ohne Gottesbaum
möglich.
Der Pythagoräismus
durch die Geschichte
Obwohl ich mich während
meines Geschichtsstudiums mit einigen Fragen beschäftigte,
gab es doch Bereiche, die ich nie genauer untersuchte.
Im Jahre 1981 rief mich ein alter Freund aus meiner
Studienzeit an und bat mich um Hilfe. Er sollte für
ein wichtiges internationales Gremium Material über
Ökologie und über Tierschutz aus den ältesten
historischen Quellen zusammentragen. Ich rief gleich
bei Dr. Skriver an. Er meinte anfangs, es gäbe
keinen Überblick über diese Fragen. Doch
am nächsten Tag schrieb er mir, es gäbe
doch ein Buch, das mir hier weiterhelfen könnte,
Robert Springer's "Enkarpa",
Kulturgeschichte der Menschheit im Lichte der pythagoräischen
Lehre. Das Buch war 1884 in Hannover erschienen.
In wenigen Tagen hatte
ich das Buch in Händen. Und es stellte sich heraus,
dass es eines jener Bücher war, das wieder ein
ganz neues Gebiet erschloss. Es beschäftigte
sich mit den Quellen unserer Kultur, zurückgehend
bis zu den Ägyptern, Indern, Israeliten und dann
weitergehend zu den griechischen, römischen und
neuzeitlichen Philosophen. Ganz erstaunlich war
für mich die Erkenntnis, dass alle großen
Denker wussten, worin die Ursachen unseres Elends
gründen. Die Quintessenz aller Aussagen lautet:
"Leid gibt es nur deshalb in der Welt, weil
der Mensch, wenn auch unwissentlich, die Naturgesetze
übertritt." Die Philosophen beobachteten
ja immer die Entwicklung der Welt nach dem Gesetz
der Ursache und Wirkung, denn sie wollten erkennen,
wie die Dinge zusammenhängen, um dann Schlussfolgerungen
für ein glückliches Leben aus diesen Erkenntnissen
zu ziehen. Alle großen Philosophen haben das
Wesentliche gewusst, nur hat jeder seine Akzente verschieden
gesetzt, je nachdem, welche Details er studiert und
beobachtet hat. In dem "Notwendigsten",
in dem was die "Not wendet" aber waren sich
alle einig. Die ganze hellenistische Kultur
basierte auf der Einsicht des "reinen Lebens".
|

